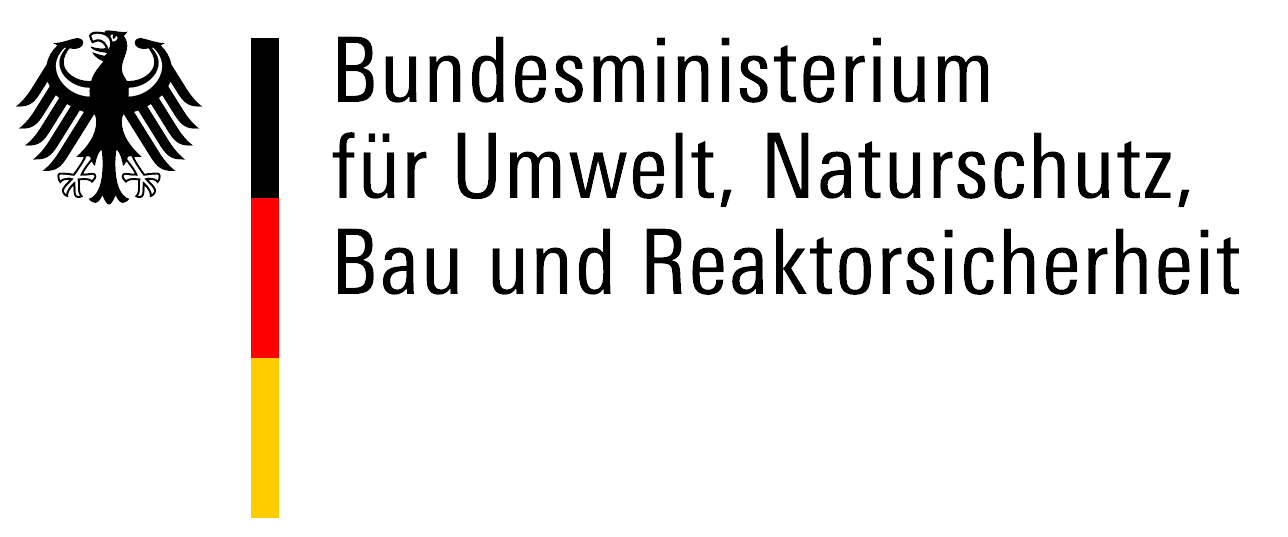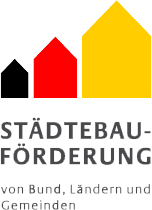Klimafolgenanpassung rückt auch in Rheine in den Fokus / Ernteausfälle und Niedrigwasser in der Ems
RHEINE. Belém in Brasilien. Rund 8.000 Kilometer entfernt von Rheine verhandeln Delegierte aus fast 200 Ländern aktuell auf der Klimakonferenz über globale Ziele in Sachen Klimaschutz. Weit entfernt von dieser großen Bühne hat Rheine einen eigenen „Masterplan 100% Klimaschutz“, der den Klimawandel auf kommunaler Ebene identifiziert und lokale Herausforderungen und Antworten darauf erarbeitet. Ernteausfälle und Niedrigwasser in der Ems bestätigen bereits ein Jahr nach Erstellung düstere Prognosen dieses Plans. Während die Folgen des Klimawandels schneller eintreten, kommt die Stadt bei der Anpassung langsam, aber stetig voran.
Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Wo steht die Stadt heute, Ende 2025?
Der Masterplan blickt nicht nur auf die Reduzierung von CO2 (Klimaschutz), sondern auch auf die Klimafolgenanpassung. Hierbei geht es nicht mehr nur darum, ob der Wandel gestoppt werden kann, sondern darum, wie sich Rheine auf die bereits unvermeidbaren Folgen vorbereitet. Die Stadt ließ dafür 2020 eine Bewertung durchführen. Das Ergebnis wird im Masterplan von 2023 als „ernüchternder Wert“ zitiert: Rheine erreichte einen Erfüllungsgrad von „nur“ 33 Prozent.
Auf Anfrage unseres Medienhauses schätzt die Verwaltung den aktuellen Erfüllungsgrad „vorsichtig“ auf etwa 50 Prozent. Zwar sei mittlerweile ein eigenständiges Anpassungskonzept für Klimafolgen erstellt worden, die Stadt befinde sich aber „noch mitten im Umsetzungsprozess.“ Die größte Herausforderung liege bei der „systematischen Integration in konkrete Verwaltungsabläufe“.
Während die Verwaltung also noch abstimmt und integriert, wandelt sich das Klima allerdings weiter. Die Warnungen des Masterplans vor Ernteausfällen und sinkenden Ems-Pegeln sind keine Theorie mehr. Das bestätigt die Stadt auf Anfrage: „2024 wurden aus der Landwirtschaft in der Region erstmals vermehrt Meldungen über Spätfröste und Dürreschäden gemeldet.“ Die Ernteerträge lagen teils „bis zu 15 Prozent unter dem langjährigen Mittel“. Auch im Tourismus wird es spürbar: Betreiber von Kanuverleihen berichteten über „verlängerte Sperrzeiten durch Niedrigwasserstände der Ems“, besonders im Juli und August 2024. „Allerdings wurden noch keine existenziellen Verluste gemeldet – die Tourismuswirtschaft reagiert bislang resilient“, schreibt die Stadt.
Dennoch sei etwas passiert – vor allem mit Entsiegelung bzw. Begrünung von Flächen will die Stadt in Richtung Klimaanpassung steuern. Dafür dient etwa das gerade entstehende Europaviertel am Waldhügel als Pilotprojekt. Dies wird nach Prinzipien der „Schwammstadt“ realisiert. Das bedeutet: Statt Regenwasser direkt in die Kanalisation zu leiten, wird es vor Ort wie von einem Schwamm aufgesaugt. Dort wurden konkrete Flächen entsiegelt, mit begrünten Mulden und Retentionsräumen zur Rückhaltung von Wasser ausgestattet. Dieses gespeicherte Wasser kann dann bei Hitze verdunsten und die Umgebung kühlen, während es bei Starkregen das Kanalsystem entlastet. Kleinere Maßnahmen (etwa auf Spielplätzen) folgten in Elte und Mesum.
Allerdings räumt die Stadt auch ein: „Eine stadtweite Entsiegelungsoffensive steht noch aus – vor allem mangelt es an finanzieller Verstetigung.“ Heißt: Für den großen Wurf fehlt wohl schlicht das Geld. Hinzu kommt, dass die Vorgaben im Masterplan für private Bauherren „rechtlich nicht bindend“ sind. Ein Dilemma, das dem Klimawandel wohl ziemlich egal sein wird.
In der Antwort auf unsere Anfrage übt die Stadt Rheine Kritik an der aktuellen Klimakonferenz. Sie bezeichnet die bisherige Beschlusslage der Zusammenkunft in Belém als „unzureichend“.
Es fehle eine verbindliche globale Ausstiegsfrist für fossile Subventionen. „Ohne diese sind kommunale Klimapläne wie der Masterplan langfristig untergraben“, lautet die Warnung aus dem Rathaus. Die Stadt Rheine fordere außerdem schon lange verbindliche Pflichten zur Berichterstattung in der Land- und Forstwirtschaft ein. Pressesprecher Frank de Groot-Dirks führt darüber hinaus aus: „Rheine kann seine lokalen Ziele nur erreichen, wenn der internationale Rahmen glaubwürdig bleibt. Lokaler Klimaschutz funktioniert nicht im luftleeren Raum. Ohne weltweite Emissionssenkung wird jede Anpassung hierzulande ein permanenter Wettlauf gegen die Eskalation.“
Die Jahrestemperatur in Rheine ist im Vergleich zu den Jahren 1961 bis 1990 um 0,7 Grad Celsius gestiegen. Die Anzahl der sogenannten „Sommertage“ (über 25 Grad Celsius) hat sich von 20 auf 29 Tage erhöht. Gleichzeitig ist auch die Zahl an Frost- und Eistagen gesunken. „Starkregenereignisse“ und „Trockenperioden mit Wassermangel“ seien bereits heute in Rheine spürbare Extreme, heißt es im Klimaschutz-Masterplan. Allerdings stellt dieser auch klar: Die Kommune hat nur auf rund 20 Prozent der Emissionen direkten Einfluss. Weitere 20 Prozent sind zusätzliche „Handlungsspielräume“, etwa über die Beratung Dritter wie den Stadtwerken. Zwischen 40 und 60 Prozent Einfluss liegen beim Bund, beim Land NRW und bei Akteuren der freien Marktwirtschaft. „Der Handlungsspielraum ist eingeschränkt, aber vorhanden“, heißt es im Papier.
Quelle: Münsterländische Volkszeitung, 15.11.2025, © Altmeppen Verlag GmbH & Co. KG ,
alle Rechte vorbehalten.